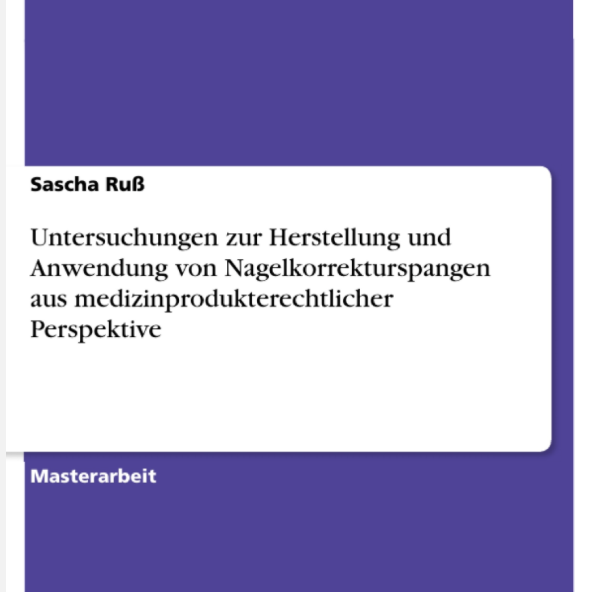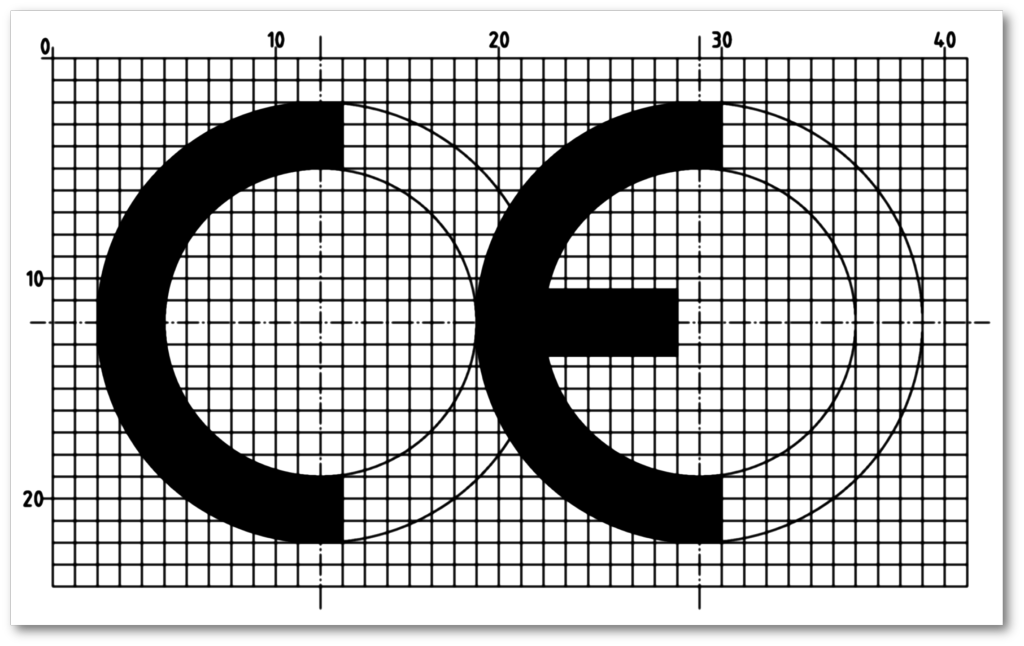Anbau an Bestandsanlage - Greift der Bestandsschutz?
18. Januar 2020

Per Mail erreichte mich eine Anfrage, die das Thema Bestandsschutz bei Altanlagen beinhaltete: Gegeben sei der Fall einer Bestandsanlage, die nach einer bereits ersetzten Normversion abgenommen und qualifiziert ist. Wie verhält es sich, wenn nun im Versorgungsbereich der Anlage ein neuer Raum entsteht bzw. ein Klasse II-Raum zu einem OP der Klasse Ib aufgerüstet werden soll?
Zunächst muss klar gesagt werden, dass ein Bestandsschutz immer ein Zugeständnis der Aufsichtsbehörde ist und widerrufen werden kann, wenn technische und/oder medizinische Gründe dagegen sprechen. Es kann also kein Gewohnheitsrecht abgeleitet werden, wenn bereits ein Versorgungsbereich X dem Bestandsschutz unterliegt, nach dem neu angebaute Teile ebenfalls darunter fallen. Darüber hinaus widerspricht es dem Sinn eines Bestandsschutzes, der vor unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Unkosten eines Umbaus schützen soll, wenn man neue Bereiche bewusst nach einem nicht mehr aktuellen Stand der Technik errichtet. Es kann weder im Sinne des Betreibers noch des Patienten sein, wenn eine neue Anlage vorsätzlich nach unzeitgemäßen Vorgaben gebaut wird.
Die DIN 1946-4 enthält weder in der Fassung von 2008 noch 2018 eine klare Handlungsanweisung, wie zu verfahren ist, wenn eine bestehende Anlage, die nach einer veralteten Normversion gebaut wurde, erweitert werden soll. Es wird für alle Arten von Baumaßnahmen - im speziellen Neubau, Umbau, Rückbau, Stilllegung oder Erweiterung - nur grundsätzlich gesagt:
"Es empfiehlt sich eine Risikoanalyse unter Berücksichtigung der Art der Bestandssituation." (DIN 1946-4:2018-06; A.2.2)
Damit wäre diese Frage eigentlich schon beantwortet: Soll zum Versorgungsbereich einer Bestandsanlage ein neuer Raum hinzugefügt oder ein bestehender Raum umgebaut werden, ist im Rahmen einer Risikoanalyse abzuklären, ob nur ein geringfügiger Umbau stattfindet oder die Umbaumaßnahmen einen Grad überschreiten, der die Anwendung der neuesten Normversion erzwingt. Die Frage ist jedoch, wann ein Umbau geringfügig und wann er so weitgehend ist, dass ein Bestandsschutz ggf. nicht mehr greift. Die getroffenen Überlegungen sollten gut durchdacht und begründet sein, schließlich muss die zuständige Aufsichtsbehörde dem ganzen letztendlich noch zustimmen.
In der europäischen Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG), der auch Raumlufttechnische Anlagen unterliegen, wird eine den sicheren Betrieb betreffende Änderung als "wesentliche Veränderung" bezeichnet und im Interpretationspapier zum Thema "Wesentliche Veränderung von Maschinen" des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales konkretisiert. Da diese Richtlinie sehr allgemeingültig ist, kann auch anhand des Interpretationspapiers freilich nicht konkret benannt werden, ab wann eine RLT-Anlage wesentlich verändert wird. Es werden aber Hinweise gegeben, was im Rahmen der Risikoanalyse ins Gewicht fallen sollte:
"Jede Veränderung an einer Maschine, unabhängig ob gebraucht oder neu, die den Schutz der Rechtsgüter des ProdSG [Produktsicherheitsgesetz; Anm.] beeinträchtigen kann, z. B. durch Leistungserhöhungen, Funktionsänderungen, Änderung der bestimmungsgemäßen Verwendung (wie durch Änderung der Hilfs-, Betriebs- und Einsatzstoffe, Umbau oder Änderungen der Sicherheitstechnik), ist zunächst im Hinblick auf ihre sicherheitsrelevanten Auswirkung zu untersuchen. [...] Dies bedeutet, es ist in jedem Einzelfall zu ermitteln, ob sich durch die Veränderung der (gebrauchten) Maschine neue Gefährdungen ergeben haben oder ob sich ein bereits vorhandenes Risiko erhöht hat."
Im weiteren Verlauf des Dokuments werden Gefährdungsarten definiert und der nötige Handlungsrahmen für die jeweiligen Arten festgesetzt, deren Umfang den hiesigen Rahmen sprengen würden. Es ist in jedem Fall sinnvoll sich dieses Interpretationspapier zu Hilfe zu nehmen, um eine solche Risikoanalyse durchzuführen. Kommt man zu dem Schluss, dass der geplante Bauumfang zu einer "wesentlichen Veränderung" führt, dann gilt:
"Die wesentlich veränderte Maschine wird wie eine neue Maschine behandelt."
Unter diesen Umständen einen Bestandsschutz aufrecht zu erhalten, dürfte schwierig vermittelbar sein.
Um zur ursprünglichen Frage des Bestandsschutzes zurückzukehren: Diese kann nicht allgemeingültig beantwortet werden, sondern unterliegt immer einer individuellen Analyse der Bestandssituation und der geplanten Änderungen. Es kann sinnvoll sein, sich über Alternativen Gedanken zu machen, da sich die Komplettsanierung der RLT-Anlage wegen des Umbaus eines einzelnen Raumes finanziell vermutlich nicht lohnen würde. Eine mögliche Alternative wäre, den neu zu errichtenden Raum separat zu versorgen. Je nach Größe und geplanter Raumklasse könnte eine mobile oder feste Kleinanlage möglich sein. Diese kann in Abhängigkeit der zu erwartenden Nachrüstarbeiten kostengünstiger sein. Ist dies nicht der Fall, ist ein Gesamtumbau - auch im Sinne der Patientensicherheit - der bessere Weg.
Ist die Bestandsanlage nach der Norm von 2008 gebaut und es steht ein Anbau an, ist das Risiko der Notwendigkeit einer Nachrüstung der Anlage überschaubar. Die Unterschiede zwischen DIN 1946-4:2008 und -:2018 sind so marginal, dass es gut möglich ist, dass sich die Anlage ohne größere Veränderungen in die Abnahme nach -:2018 übernehmen lässt. Hier wäre es sinnvoll, in der Planungsphase eine interne Begehung der Anlage unter Berücksichtigung von Kapitel 6 der DIN 1946-4:2018 durchzuführen. Ist die Anlage konsequent nach DIN 1946-4:2008 gebaut, werden hier nur in Ausnahmefällen Abweichungen nach aktueller Norm zu finden sein. Ist die Anlage jedoch nach einer älteren Norm gebaut, ist eine Sanierung im Rahmen eines An-/ oder Umbaus ggf. unumgänglich.
Zusammenfassung: Erstellen Sie eine Bestandsanalyse unter Beteiligung der Technik- und der Hygieneabteilung. Hierbei muss geklärt werden, welcher Bauumfang geplant ist und welchen Einfluss dieser auf die Bestandsanlage hat (Risikobeurteilung). In Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde muss dann entschieden werden, welche Maßnahmen zur Anpassung der Anlage ergriffen werden - zu berücksichtigen sind finanzielle, sicherheitsbezogene und medizinische Aspekte.
Teilen
Tweet
Teilen
E-Mail
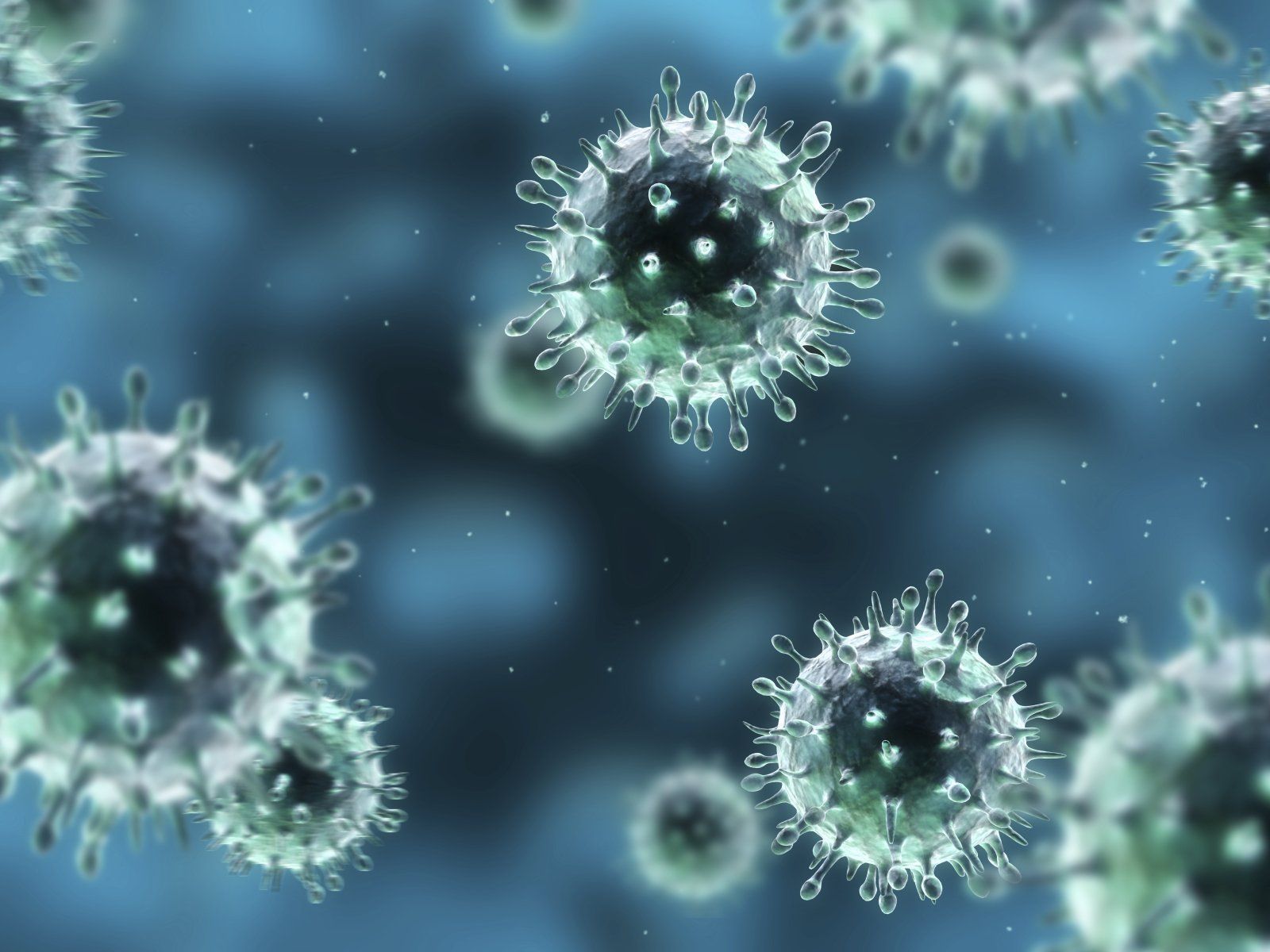
8. März 2023
Die KRINKO-BfARM-Empfehlung, deren Einhaltung eine ordnungsgemäße Aufbereitung gem. §1 (2) MPBetreibV vermuten lässt, macht klare Vorgaben zur Wirksamkeit von Desinfektionsverfahren. Insbesondere bei der manuellen Desinfektion zeigt sich eine Tücke, die bei vielen Betreibern vermutlich nicht genug Beachtung findet.

25. Januar 2023
In besonderen Situationen ist es manchmal nicht möglich, medizinische Instrumente selbst aufzubereiten – sei es weil der Sterilisator defekt ist oder in der Praxis umgebaut wird. Ist es dann ohne weiteres möglich, die Aufbereitung einfach von einer anderen Praxis oder einem Dienstleister durchführen zu lassen?
Hyg-Blog.de ist lizensiert unter CC BY-ND 4.0